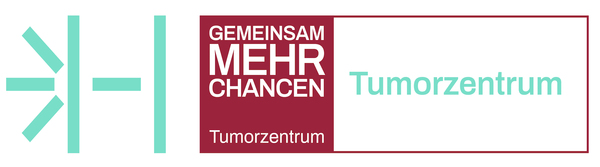Schlafstörungen bei Krebsbetroffenen
Schlafstörungen bei Krebspatient*innen sind weit verbreitet, werden jedoch häufig bagatellisiert. Weshalb es sich lohnt, den Ursachen auf den Grund zu gehen und nicht einfach zu Schlafmitteln zu greifen, erklären Dr. Diana Zwahlen und Dr. Carole Kaufmann vom Unispital Basel im Interview.
Expertinnen im Gespräch
Ab wann spricht man von einer Schlafstörung?
Diana Zwahlen: Eine Schlafstörung ist weitgehend über das subjektive Erleben definiert. Hierbei kann es sich um Ein,- und Durchschlafstörungen oder häufiges oder frühes Erwachen handeln. Für manche Betroffene stellt das keinen Leidensdruck dar, andere wiederum fühlen sich dadurch stark beeinträchtigt. Dann spricht man von einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Ich gehe davon aus, dass deutlich mehr Krebspatient*innen von einer Schlafproblematik betroffen sind als wir annehmen. Patient*innen sprechen Schlafprobleme erst mit hohem Leidensdruck an und in der onkologischen Sprechstunde wird die Schlafqualität selten explizit angesprochen.
Carole Kaufmann: Ein entscheidender Punkt ist der Leidensdruck. Manche Menschen fühlen sich topfit mit vier Stunden Schlaf und nutzen das nächtliche Erwachen etwa um zu Lesen. Guter Schlaf ist etwas sehr Individuelles und muss auch so angeschaut werden.
Ängste, Sorgen und nächtliches ‘Grübeln’ – sind überwiegend psychologische Faktoren schuld an Schlafstörungen bei Krebspatient*innen?
Diana Zwahlen: Die Schlafproblematik ist oft sehr vielschichtig und neben psychischen Auslösern spielen auch körperliche Faktoren eine zentrale Rolle. So können bestimmte Medikamente der Krebstherapie Schlafstörungen zur Folge haben. Manche Patient*innen müssen vermehrt auf die Toilette oder leiden nachts unter Schmerzen und Übelkeit. Die seelische Belastung verstärkt oder begünstigt Einschlafschwierigkeiten, die Betroffenen kommen ins Grübeln, Ängste und Gedanken drehen sich. Es beginnt ein Teufelskreis, aus dem die Patient*innen oft nur schwer herausfinden.

Dr. Carole Kaufmann und Dr. Diana Zwahlen vom Unispital Basel
Der Griff zum Schlafmittel scheint hier ein einfacher Problemlöser.
Carole Kaufmann: Bevor man ein Schlafmittel verschreibt, sollte man den Ursachen der Schlafstörung auf den Grund gehen. Hat die Patient*in etwa nächtliche Schmerzen, kann vielleicht die Schmerztherapie angepasst werden. Oder gibt es Medikamente, die die Patient*in bereits einnimmt und die sich negativ auf das Schlafverhalten auswirken? Möglicherweise können diese ersetzt werden. In jedem Fall ist es zentral, dass man sich Zeit für die Patient*in nimmt und gemeinsam versucht herauszufinden, wo die Problematik liegen könnte. Diverse Studien zeigen, dass psychologische Begleitung und Schlafhygiene langfristig oft wirkungsvoller sind als Medikamente. Der Effekt zeigt sich aber oftmals weniger schnell. Hier ist Geduld gefragt, sowohl von Seiten der Patient*innen, wie auch der betreuenden Gesundheitsfachpersonen. Ein Schlafmittel kann in der Anfangszeit für die Patient*en eine zusätzliche Unterstützung darstellen.
Schlafstörungen werden in der Sprechstunde zu wenig angesprochen. Weshalb?
Diana Zwahlen: Schlafstörungen werden von den Betroffenen vielfach als nötiges Übel angesehen und tatsächlich oft nicht thematisiert. Im Sinne von «es existieren ganz andere Probleme, die wichtiger sind». Schlafstörungen sollten jedoch ernst genommen werden. Ich rate deshalb den Betroffenen, sich vor der Sprechstunde eine Liste mit Fragen und vorhandenen Problemstellungen zu machen und dabei Schlafprobleme zu inkludieren.
«Bevor man ein Schlafmittel verschreibt, sollte man den Ursachen der Schlafstörung auf den Grund gehen.»
Welche Folgen kann Schlaflosigkeit für die Betroffenen haben?
Diana Zwahlen: Wer über einen längeren Zeitraum unter Schlafstörungen leidet, dem fehlt die nötige Erholung, die der Körper dringend bräuchte. Man ist in der Folge dünnhäutiger, ängstlicher, leidet unter Tagesmüdigkeit und vermeidet vielleicht auch Sozialkontakte. Manchmal entwickelt man eine regelrechte Aversion gegen die Nacht und fürchtet sich vor dem Schlaf. Man steigert sich immer mehr in die Schlaflosigkeit hinein, verstärkt sie und landet in einer Angstspirale.
Welche Möglichkeiten gibt es, um solch eine Angstspirale zu vermeiden?
Diana Zwahlen: Die Schlafhygiene spielt hier eine entscheidende Rolle. Dazu gehören Rituale, wie spazieren gehen, lesen oder Entspannungstechniken vor dem Schlafen. Welche Rituale helfen, ist jeweils sehr individuell. Nicht förderlich ist Fernsehen oder der Handygebrauch vor dem zu Bett gehen. Zudem sollte man erst ins Bett gehen, wenn man müde ist und das Bett auch nur zum Schlafen nutzen. Ebenso hilft Bewegung am Tag. Sind kreisende Sorgengedanken regelmässige nächtlichen Begleiterin, sollte psychologische Unterstützung in Anspruch genommen werden.
Carole Kaufmann: Manchmal braucht es ein schlafförderndes Medikament, das mithilft den Angstkreislauf zu durchbrechen. Das kann, je nach Präferenz, in chemischer als auch in pflanzlicher Form sein. Ich plädiere jedoch dafür, den Einsatz von Schlafmittel gut zu überlegen und bewusst einzusetzen. So können die Medikamente vorübergehend durchaus helfen. Wichtig ist, dass man mit der behandelnden Ärztin, Psychologin oder Apothekerin redet und nicht auf eigene Faust Schlafmittel kauft und einnimmt. Es besteht immer die Gefahr von Interaktionen mit den bereits bestehenden Medikamenten. Und das kann gefährlich sein.
Datum: 24.04.2023

Im Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel werden Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Krebs von einem hoch spezialisierten Behandlungsteam betreut und begleitet. Fachleute verschiedener Disziplinen sorgen gemeinsam für eine Krebstherapie nach aktuellem Forschungsstand. Geleitet wird das Tumorzentrum von PD Dr. Benjamin Kasenda und Dr. Astrid Beiglböck.
www.unispital-basel.ch/tumorzentrum