
Blasenkarzinom – Selbst-Stigma verhindern

Beim Blasenkarzinom können Behandlung, wiederholte Kontrollen und Therapien für Betroffene belastend sein. Kommen Stoma, Katheter und Urinbeutel hinzu, neigen viele Patient*innen zur Selbst-Stigmatisierung, obwohl das Umfeld davon meistens nichts mitbekommt.
Dr. von Burg, mit welchem Stigma ist Blasenkrebs behaftet?
Dr. von Burg: Das zeigt sich individuell sehr unterschiedlich und dürfte auch durch das soziale und wirtschaftliche Umfeld von Betroffenen beeinflusst sein. Auch Alter, Geschlecht und zusätzliche Erkrankungen spielen eine Rolle. Im Normalfall fühlen sich Betroffene durch die Diagnose Blasenkrebs nicht stigmatisiert. Es sind eher die Begleitumstände der therapeutischen Massnahmen wie Stomas, d.h. ein künstlicher Blasenausgang, sowie Urinbeutel, wo die Selbst-Stigmatisierung anfängt. Ein Thema ist auch die Inkontinenz oder Blut im Urin.
Auch im öffentlichen Bewusstsein wird Blasenkrebs nicht mit «Schuld» assoziiert, wie beispielsweise bei der Verknüpfung von Lungenkrebs mit Rauchen. Betroffene fragen oft nach der Ursache der Erkrankung. Da zeigt es sich, dass den meisten die Risikofaktoren von Blasenkrebs, wie beispielsweise das Rauchen, nicht bewusst sind.
Welche Auswirkungen hat das Stigma auf die Diagnose und Behandlung von Patient*innen?
von Burg: Wenn Patient*innen eine Stomaversorgung benötigen, oder mit einem Urinbeutel am Körper ihren täglichen Aktivitäten nachgehen, dann können sich schon Probleme bei der Pflege einstellen. Es kann sein, dass es nach Urin riecht. Damit trauen sich die Betroffenen weniger aus dem Haus. Es leidet die Teilnahme an sozialen Kontakten. Auch Reisen oder sportliche Aktivitäten sind unter Umständen nicht mehr in der gleichen Form möglich wie vorher. Hier kann es also klare Einschränkungen im Alltag geben. Auf die Behandlung selbst hat das Stigma kaum einen Einfluss.
Wie können Betroffene und ihre Angehörigen mit diesem Stigma besser umgehen?
Dr. von Burg: In der Frühphase der Erkrankung sind häufig kleinere Eingriffe mittels Blasenspiegelung erforderlich. Das kann sehr belastend sein, denn es stellt sich jedes Mal die Frage, ob bei der nächsten Spiegelung der Tumor zurück gekommen ist. Bei lokal fortgeschrittenen Krebsformen und Metastasierungen geht es dann um existenzielle Fragen. Wie ist die Prognose? Gibt es noch Heilung? Was sind die Folgen der Therapie wie beispielsweise Nebenwirkungen?
Häufig handelt es sich um ältere Patient*innen, meist über 70 Jahre alt und oft auch mit anderen Begleiterkrankungen belastet. Die Unterstützung durch das soziale Umfeld kann in diesem Alter eingeschränkt sein, häufig fehlen die Ehepartner*innen oder diese sind gesundheitlich auch angeschlagen. Hier braucht es externe Unterstützungs- und Betreuungsleistungen wie beispielsweise hausärztliche Betreuung, Spitex, Psychoonkologie sowie eine spezifische Pflegeversorgung bei Vorhandensein von Stoma und Urinbeutel.
Im Normalfall fühlen sich Betroffene durch die Diagnose Blasenkrebs nicht stigmatisiert. Es sind eher die Begleitumstände der therapeutischen Massnahmen wie Stomas, d.h. ein künstlicher Blasenausgang, sowie Urinbeutel, wo die Selbst-Stigmatisierung anfängt.
Welche Rolle spielen Gesundheitsexpert*innen, die Öffentlichkeit und die Medien bei der Verringerung des Stigmas?
von Burg: Mir scheint aufgrund der relativen Seltenheit der Erkrankung, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit, beziehungsweise in den Medien keine grosse Beachtung findet. Die Ansprache von Betroffenen auf spezifischen Kanälen wäre jedoch sinnvoll.
Wie können wir nicht Betroffene uns verhalten, um diesem Stigma entgegenzuwirken?
von Burg: Nicht-Betroffene realisieren das Selbst-Stigma in der Regel gar nicht. Weil den Patient*innen äusserlich nicht anzusehen ist, ob sie ein Stoma, einen Dauerkatheter oder Urinbeutel tragen. Es kann eventuell riechen, doch Aussenstehende machen selten eine Verbindung zu einem Betroffenen. Ich würde das Verhalten lieber auf die Vorsorge des Blasenkarzinoms richten. Neuauftretende Symptome im Blasenbereich, insbesondere Blut im Urin, sollten immer ärztlich abgeklärt werden.
CH-AVEBL-00195 03/2023
Datum: 23.10.2023
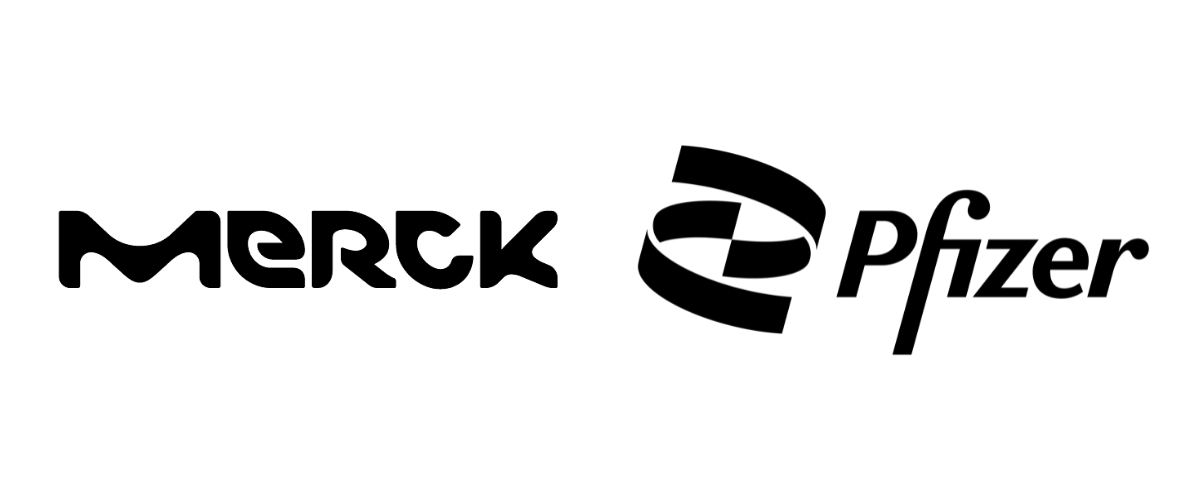
Merck (Schweiz) AG und Pfizer AG setzen sich gemeinsam für eine bestmögliche Therapie gegen Krebs ein. Dabei konzentriert sich auch die globale strategische Allianz zwischen Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und Pfizer Inc. auf die Immunonkologie und profitiert vom Know-How beider Unternehmen. Wir entwickeln im Verbund hoch-rangige internationale klinische Programme und wollen neue Ansätze zur Krebsbehandlung finden.