
«Die Komplementärmedizin bietet Patientinnen mehr Zeit»
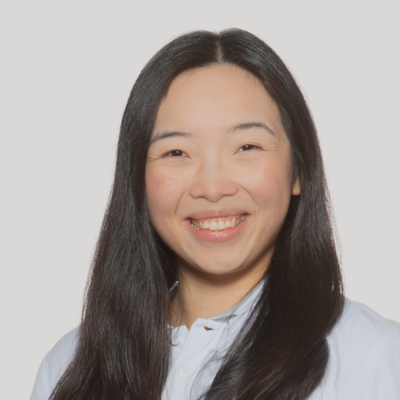
Wenn eine Krebsdiagnose gestellt wird, versuchen viele Patientinnen und Patienten alle Therapiemöglichkeiten zu nutzen – auch solche ausserhalb der Schulmedizin. Die auf Krebsbehandlungen spezialisierte Gynäkologin Dr. med. Isabell Ge erklärt im Interview, was funktioniert, wovon sie abrät und worauf Betroffene bei einer Internetrecherche achten sollten.
Dr. Ge, viele Krebspatientinnen und Krebspatienten suchen nach zusätzlichen Möglichkeiten, um besser mit ihrer Erkrankung umzugehen. Was begegnet Ihnen in Gesprächen mit Patienten am häufigsten, wenn es um komplementäre Methoden geht?
Dr. Isabell Ge: Der Grossteil der Patientinnen stellt sich in unserer Sprechstunde am Universitätsspital Basel mit dem Ziel vor, Symptome der Krebserkrankung und Therapie-Nebenwirkungen zu reduzieren. Die häufigsten Beschwerden sind Schmerzen, Fatigue, Wechseljahresbeschwerden und psychische Belastung. Danach folgt der Wunsch nach Stabilisierung von Körper, Seele und Geist sowie die Verbesserung der Lebensqualität. Auch die Vorbeugung eines Wiederauftretens der Erkrankung sowie Optimierung der Prognose sind Themen, welche die Patientinnen oft mitbringen.
Gerade in einer so belastenden Situation wie einer Krebsdiagnose wünschen sich viele Menschen mehr Ganzheitlichkeit in der Behandlung. Welche Rolle kann die Komplementärmedizin hier realistisch übernehmen?
Ge: Die Komplementärmedizin kann eine wichtige unterstützende Rolle übernehmen. Wenn die Patientinnen in die Sprechstunde kommen, ist es das Ziel, die Person und ihr Umfeld hinter der Erkrankung besser kennenzulernen. Dafür habe ich in der komplementärmedizinischen Konsultation den Luxus, mir mehr Zeit nehmen zu dürfen, in einem geschützten Raum die individuellen Hintergründe, Bedürfnisse, Werte und Erfahrungen besser zu verstehen. So können wir passend dazu beraten und die geeigneten Therapieformen empfehlen.
Gibt es Grenzen?
Ge: Ja, ganz klar. Komplementärmedizin darf nicht mit Alternativmedizin verwechselt werden. Letztere lehnt die konventionelle Krebstherapie ab – das ist gefährlich und kann den Krankheitsverlauf verschlechtern. Die Grenzen liegen dort, wo Methoden nicht wirksam oder sogar schädlich sind, wo sie mit onkologischen Therapien wechselwirken oder falsche Hoffnungen wecken.
Komplementärmedizin darf nicht mit Alternativmedizin verwechselt werden. Letztere lehnt die konventionelle Krebstherapie ab – das ist gefährlich und kann den Krankheitsverlauf verschlechtern.
Welche komplementärmedizinischen Verfahren setzen Sie am Unispital Basel konkret ein? Können Sie an einem Beispiel zeigen, wie damit Patientinnen geholfen wird?
Ge: Wir bieten zusätzlich zur individuellen Einzelberatung Therapieformen wie Akupunktur und Ohrakupunktur, Hypnose, Yoga und pflanzliche Präparate an, oder zeigen Patientinnen Selbsthilfemassnahmen wie Aromatherapie und Selbst-Akupressur. Akupunktur hilft bei vielen Beschwerden, insbesondere Schmerzen. Sie eignet sich aber auch zur Chemotherapie-Begleitung. Hypnose und Aromatherapie können bei Übelkeit und zum psychischen Ausgleich eingesetzt werden. Yoga kann Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen und Fatigue lindern.
Wie entscheiden Sie, welche Methode für welchen Patienten geeignet ist? Gibt es bestimmte Kriterien oder Kontraindikationen?
Ge: Es gibt drei Kriterien: Erstens, die Methode wurde in Studien untersucht und es konnte eine wissenschaftliche Wirksamkeit gezeigt werden. Zweitens, der Patientenwunsch wird berücksichtigt. Drittens, Wissen über die Krebserkrankung und die konventionellen Therapien liegt vor. Ich würde zum Beispiel bei einem hormonabhängigen Brustkrebs keine pflanzlichen Präparate mit hohem Östrogengehalt empfehlen. Auch einer Patientin mit Nadelphobie würde ich keine Akupunktur aufzwingen.
Viele Patienten suchen auf eigene Faust nach Therapien im Internet. Was gilt es dabei zu beachten?
Ge: Dass Patientinnen selbst nach Informationen suchen, ist verständlich. Aber im Internet ist es nicht einfach, zu unterscheiden, welche Inhalte seriös sind und welche nicht. Besonders kritisch zu hinterfragen sind Angebote, die direkt Heilung versprechen oder hohe Kosten verursachen. Ich empfehle daher immer, das Gespräch mit dem Behandlungsteam zu suchen. Wir nehmen Eigenrecherche ernst und prüfen gemeinsam mit den Patientinnen, welche Verfahren für ihre Situation sicher und sinnvoll sind.

Gibt es Methoden, von denen Sie klar abraten?
Ge: Ich rate von allem ab, das gesundheitsgefährdend oder giftig ist. Etwa die sogenannnten MMS-Tropfen oder Aprikosenkerne. Andere Therapien sind manchmal ungeeignet, weil sie die Effizienz der Krebstherapie beeinträchtigen können, zum Beispiel hochdosierte Antioxidantien während Chemotherapien oder Bestrahlung.
Wie ist das Zusammenspiel zwischen schulmedizinischer Onkologie und komplementären Angeboten bei Ihnen im Haus organisiert? Hat die Komplementärmedizin das richtige Gewicht?
Ge: Am Universitätsspital Basel ist das Zusammenspiel zwischen schulmedizinischer Onkologie und komplementären Angeboten integrativ gestaltet. Die Angebote sind eng auf die onkologischen Behandlungspfade abgestimmt, sodass Doppelstrukturen und Wechselwirkungen vermieden werden. So können bereits in der normalen onkologischen Konsultation komplementärmedizinische Empfehlungen abgegeben werden. Für eine tiefgründige Konsultation und Behandlung steht dann aber die komplementärmedizinische Sprechstunde zur Verfügung.
Welche Rolle sehen Sie für die Komplementärmedizin in der Zukunft?
Ge: Ich sehe Komplementärmedizin als festen Bestandteil einer patientenzentrierten, integrativen Krebsmedizin. Durch meine Tätigkeit erlebe ich immer wieder, wie Patientinnen nur profitieren können vom Besten aus beiden Welten. Es ist wichtig für die Zukunft, diese Verfahren noch stärker wissenschaftlich zu evaluieren, und die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich auszubauen, damit die Methoden sinnvoll und sicher in die reguläre Versorgung integriert werden können.
Datum: 09.10.2025