
«Trauen Sie sich, Unterstützung zu suchen!»
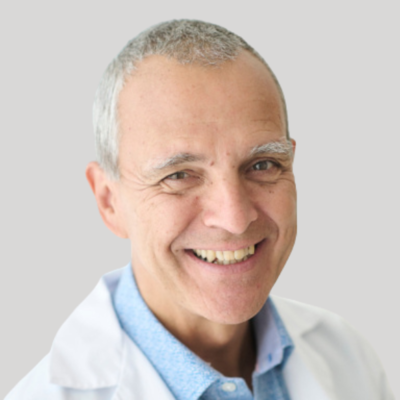
Der Onkologe Pierre-Yves Dietrich hat erneut das Präsidium der Genfer Krebsliga über nommen. In einem Kontext, in dem Krebs zunehmend chronisch wird, sieht er deren Rolle immer stärker darin, Patientinnen und Patienten zu den passenden Unterstützungsstrukturen – seien sie staatlich oder von Vereinen getragen – zu begleiten.
Welche Herausforderungen haben Menschen, die mit einem Hirntumor (Gliom) leben?
Prof. Pierre-Yves Dietrich: Hirntumoren nehmen in der Onkologie eine Sonderstellung ein. Obwohl sie gewisse Gemeinsamkeiten mit anderen Krebsarten aufweisen, unterscheiden sie sich durch ihre Vielfalt: Manche Tumoren sind gutartig und können chirurgisch behandelt oder überwacht werden, während andere – wie das Glioblastom – äusserst aggressiv bleiben und grosse therapeutische Herausforderungen mit sich bringen. Die Folgen dieser Erkrankungen variieren stark je nach Art und Lage des Tumors. Entsprechend vielfältig sind die Symptome: Lähmungen, Blasen- oder Darmschwäche, Verlust von Lesefähigkeit oder Sprache, Desorientierung oder auch Verhaltensveränderungen. Das Besondere ist, dass diese Tumoren das Gehirn angreifen – das zentrale Organ von Identität und Persönlichkeit. Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen stehen damit nicht nur einer meist tödlichen Krankheit gegenüber, sondern auch tiefgreifenden Veränderungen von Persönlichkeit und kognitiven Fähigkeiten.
Wie genau wirkt sich die Krankheit auf die Angehörigen aus?
Dietrich: Wie jede Krebserkrankung hat auch ein Hirntumor weitreichende Folgen für das Gleichgewicht einer Familie – sei es finanziell, emotional oder in den Beziehungen. Alles wird durcheinandergebracht, gewohnte Abläufe brechen zusammen. Das ist für Paare belastend, aber auch für Kinder, die manchmal psychologische Betreuung brauchen. Glücklicherweise wird die Rolle der Angehörigen und pflegenden Nahestehenden seit etwa zehn Jahren stärker von den Behandlungsteams, vom Staat und von Vereinen anerkannt. Das reicht von Hausaufgabenhilfe für Kinder bis hin zu zeitweiliger Entlastung in der Betreuung oder administrativer Unterstützung. Bei der Krebsliga heissen wir Angehörige genauso willkommen wie Patientinnen und Patienten. Ihre Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und hängen von der persönlichen Situation ab. Hervorzuheben ist, dass Angehörige in den meisten Fällen diese Situation auf erstaunliche Weise bewältigen.
Zögern Sie nicht, die Organisationen in Anspruch zu nehmen. Denn das Netzwerk aus staatlichen und gemeinnützigen Strukturen ist komplex und verändert sich ständig – man kann es unmöglich alleine überblicken.
Viele Betroffene fühlen sich nach Abschluss der intensiven Behandlungen in einem Vakuum. Wie erleichtert die Krebsliga den Übergang zwischen Krankenhaus und langfristigem Alltag?
Dietrich: Tatsächlich zeigt die wissenschaftliche Literatur, dass sich viele Patientinnen und Patienten nach der akuten Krankheitsphase im Stich gelassen fühlen. Manche psychosozialen Schwierigkeiten treten gar nicht während der Behandlung auf, sondern erst drei bis fünf Jahre später, wenn die Krankheit chronisch wird. Angesichts dieser Herausforderungen spielt die Krebsliga eine Schlüsselrolle: Sie vermittelt Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen zu den passenden Ressourcen. Jede Situation ist einzigartig – es gibt keine Standardlösung. Manche brauchen Informationen zur Invalidenversicherung, andere ein berufliches Coaching, psychologische Unterstützung oder Ernährungsberatung. Diese langfristige psychosoziale Begleitung ergänzt heute die medizinische Nachsorge.
Die Krebsliga bietet auch Gesprächsgruppen an. Wie unterstützen diese die Betroffenen?
Dietrich: Wir bieten zahlreiche Gesprächsgruppen für Patientinnen, Patienten und Angehörige an. Die Themen sind vielfältig und orientieren sich an Krankheitsarten, Lebenssituationen oder Behandlungen. Sie werden in der Regel von unseren Teams identifiziert. So haben wir zum Beispiel eine spezielle Gruppe für Männer ins Leben gerufen, die grossen Zuspruch findet. Manche Teilnehmer, die zuvor nicht über ihre Krankheit oder Probleme sprechen wollten, haben dort einen Ort gefunden, an dem sie sich weniger allein fühlen. Eine weitere wichtige Aktivität der Krebsliga ist die Familienmediation. Krebs kann in Familien viele Konflikte hervorrufen. Die Wirkung solcher Sitzungen ist oft beeindruckend – sie bringen Ruhe und Harmonie zurück.

Welche Botschaft möchten Sie Menschen mit einem Gliom mitgeben?
Dietrich: Mein wichtigster Rat lautet: Zögern Sie nicht, die Organisationen in Anspruch zu nehmen, die für Ihre Unterstützung da sind. Denn das Netzwerk aus staatlichen und gemeinnützigen Strukturen ist komplex und verändert sich ständig – man kann es unmöglich alleine überblicken. Doch es ist eine wertvolle Hilfe angesichts der Herausforderung, mit einer chronischen Krankheit zu leben. Ich beobachte oft, dass Patientinnen, Patienten und Angehörige Angst haben, «das System zu stören», oder eine gewisse Scheu verspüren. Sie denken, sie müssten allein zurechtkommen – und verpassen dadurch Unterstützung, die ihnen zustehen würde. Manche Vereine bieten finanzielle Hilfe, andere Aktivitäten für Kinder, künstlerische Angebote oder Sitzungen in alternativen Heilmethoden. Vielen Menschen hilft das, sich neu aufzubauen – für einige hat es sogar ihr Leben verändert. Leider werden diese Ressourcen noch zu wenig genutzt.
Meine Botschaft lautet daher: Trauen Sie sich, zu uns zu kommen! Bei der Krebsliga empfangen Sie onkologisch geschulte Pflegefachkräfte, helfen Ihnen, Ihre Bedürfnisse zu erkennen und die passenden Angebote zu finden.
Servier unterstützt Leben mit Krebs und hatte keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Artikel.
Datum: 21.10.2025

Als führendes Unternehmen in der Kardiologie entwickelt sich Servier auch zu einem wichtigen Akteur in der Onkologie. Mit einer neuen Therpieoption bei Gliomen in der Schweiz engagiert sich Servier für die Entwicklung und den Zugang zu innovativen Behandlungen bei seltenen oder schwer behandelbaren Krebserkrankungen.