
Myelofibrose: «Erst mit der Zeit wird man zur Expertin der eigenen Krankheit.»
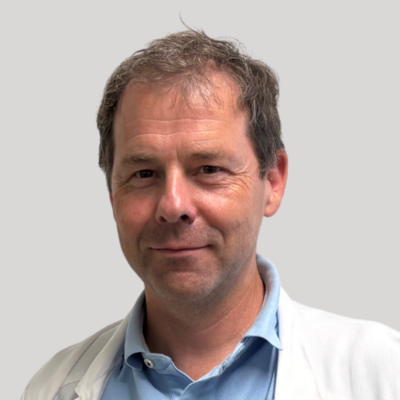
Seit 2019 lebt Esther mit Myelofibrose – und lässt sich von der Krankheit nicht bestimmen. Bewegung, ihr Garten, die Berge und der Austausch mit anderen Betroffenen geben ihr Kraft. Hämatologe Dr. Thomas Lehmann erklärt, warum die Diagnosestellung oft langwierig ist und welche Therapieoptionen heute zur Verfügung stehen.
Esther, 2019 erhielten Sie die Diagnose Myelofibrose. Welche Symptome hatten Sie damals?
Esther: Wenn ich zurückblicke, war es ein langer Weg. Vielleicht gehörten viele Beschwerden schon früher zur Krankheit, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Ich litt oft an Erschöpfung, hatte immer wieder leichtes Fieber, über 20 Jahre lang wiederholt Bronchitis und Darmentzündungen. Dazu kamen starke Kopfschmerzen. Mit 50 Jahren setzte ein extremes Nachtschwitzen ein – so heftig, dass ich wusste: das können nicht die Wechseljahre sein. Später erlitt ich eine Sinusvenenthrombose. Nach Knochenmarkspunktion und Gentest lautete die Diagnose zunächst: essentielle Thrombozytose. 2019 verlor ich stark an Gewicht, und eine erneute Punktion bestätigte dann den Übergang in eine Myelofibrose.
Dr. Lehmann, weshalb hat man die Myelofibrose nicht gleich bei der ersten Untersuchung erkannt?
Dr. Thomas Lehmann: Das ist keine Seltenheit. Manche Patientinnen entwickeln zunächst eine sogennante essentielle Thrombozytose oder eine Polycythaemia vera. Diese Erkrankungen können im Verlauf in eine Myelofibrose übergehen.
Sind die von Esther geschilderten Symptome typisch?
Lehmann: Typisch ist eigentlich, dass es keine eindeutig typischen Symptome gibt. Meist zeigen sich unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Nachtschweiss, Fieber oder Knochenschmerzen. Ein relativ deutliches Anzeichen ist eine vergrösserte Milz. Gerade weil die Symptome so unspezifisch sind, dauert die Diagnosestellung oft Jahre. Viele Patienten durchlaufen eine lange «Mühle» von Arztbesuchen, bevor die Krankheit erkannt wird.
Wie wird Myelofibrose diagnostiziert?
Lehmann: Bereits die Blutwerte können einen ersten Verdacht ergeben. Hier zeigen sich typische Veränderungen, ausserdem lassen sich genetische Mutationen im peripheren Blut nachweisen. Die Knochenmarkspunktion sichert die Diagnose endgültig ab und erlaubt die Zuordnung zum jeweiligen Subtyp.

Onkologe Dr. Thomas Lehmann begleitet Esther bereits seit vielen Jahren.
Wie ging es danach weiter, welche Therapien haben Sie erhalten?
Esther: Meine erste Diagnose, die essentielle Thrombozytose, wurde damals mit einem alten Chemotherapeutikum in Tablettenform behandelt. Die Nebenwirkung war vorallem ein unangenehmes Pieksen auf der Haut, wie tausend Nadelstiche. Später wechselte ich auf ein anderes Medikament, wodurch ich mich psychisch veränderte. Die Behandlung mit einem JAK-Inhibitor war ein Paradigmawechsel. Die Myelofibrose wurde dann mit einem JAK-Inhibitor behandelt. Das war ein Paradigmawechsel. Meine Energie kam zurück, ich konnte Schritt für Schritt wieder in meinen Alltag zurückkehren. Was mir übrigens auch hilft, ist die Komplementärmedizin.
Dr. Lehmann, welche Behandlungsoptionen gibt es heute für Patientinnen mit Myelofibrose – sowohl in der Ersttherapie als auch, wenn die Krankheit zurückkehrt?
Lehmann: Je ausgeprägter die Symptome sind, desto eher setzen wir einen JAK-Inhibitor ein. Dieser wirkt sehr rasch: Beschwerden verschwinden, die Energie steigt, die Lebensqualität verbessert sich deutlich. Esther konnte dadurch sogar wieder in den Schuldienst zurückkehren und Teilzeit als Lehrerin arbeiten. Heilen können wir die Myelofibrose derzeit nicht – mit Ausnahme einer Stammzelltransplantation. Doch diese ist nur im fortgeschrittenen Stadium sinnvoll, da sie mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die medikamentöse Therapie wird so lange fortgeführt, wie die Patienten darauf ansprechen. Manche entwickeln allerdings Resistenzen.
Stichwort Resistenzen – diese versucht man möglichst lange hinauszuzögern. Was tut sich hier in der Forschung?
Lehmann: Für die Zukunft hoffen wir auf Kombinationstherapien, die die Entwicklung von Resistenzen verhindern oder hinauszögern sowie auf Ansätze, die das Knochenmark so weit stabilisieren, dass sich die Behandlung reduzieren lässt. Unser grosser Traum bleibt eine Therapie, die die Myelofibrose tatsächlich rückgängig machen kann. Soweit sind wir leider noch nicht.
Wie geht es Ihnen heute, Esther?
Esther: Ich lebe mit meiner Krankheit, doch sie bestimmt meinen Alltag nicht. Mit dem neuen Medikament geht es mir deutlich besser, auch wenn es immer wieder körperliche Auf und Abs gibt. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die mir Freude bereiten – mein Garten, die Berge, Kulturanlässe oder aktuell das Pilzesammeln – das Positive überwiegt. Mir hilft es, die Dinge so anzunehmen, wie sie kommen. Was ich dabei gelernt habe, ist, meine Grenzen besser einzuschätzen und mir Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche. Auch den Austausch mit anderen Betroffenen empfinde ich als ungemein wertvoll.

In der Natur und bei Ausflügen kann Esther auftanken.
Wie haben Sie sich über die Krankheit informiert und wo haben Sie Unterstützung gefunden?
Esther: Anfangs habe ich mich im Internet informiert – und war ziemlich erschrocken über die Angaben zur Prognose: Ich stiess auf eine Überlebenszeit von durchschnittlich sieben Jahren und dachte nur: «Ups, da muss ich mich jetzt aber beeilen.» Zum Glück entdeckte ich das Deutsche MPN-Netzwerk und später das Schweizer Netzwerk MPN. Wir treffen uns regelmässig, rufen uns bei Bedarf an und teilen unsere Erfahrungen. Der Austausch mit anderen Betroffenen ist unglaublich bereichernd: Wir lachen viel, sprechen aber auch offen über Sterben und Endlichkeit. Mein Ziel ist es, die Krankheit positiv anzunehmen.
Dr. Lehmann, welche Fragen wünschen Sie sich von ihren Patienten?
Lehmann: Mir sind vor allem die Fragen wichtig, die die Patientinnen wirklich beschäftigen. Oft geht es aber auch darum, zu verstehen: Was von dem, was ich erkläre, kommt eigentlich bei ihnen an? Eine Diagnose trifft sie oft wie ein Schlag, und es braucht Zeit, bis die Informationen verarbeitet sind. Manche wollen alles bis ins Detail wissen, andere lieber nur das Wesentliche – da ist es wichtig, ein Gespür dafür zu haben, welche Infos wann sinnvoll sind.
Es ist auch wichtig, über Endlichkeit und Sterblichkeit zu sprechen, natürlich situationsabhängig. Gerade bei jüngeren Patienten heisst eine Myelofibrose-Diagnose, dass die Lebenserwartung eingeschränkt ist. Prognosen sind schwer, weil die Spanne gross ist – im Durchschnitt liegt sie bei fünf bis 15, manchmal auch 20 Jahren.
Was hilft aus Ihrer Sicht, damit Patientinnen informierte Entscheidungen treffen können?
Lehmann: Es gibt Patienten, die informiert Entscheidungen treffen wollen, dafür brauchen sie alle relevanten Informationen und müssen diese verstanden haben. Andere wiederum möchten das gar nicht und brauchen erst einmal Abstand. In solchen Fällen schlage ich zunächst die bestmögliche Therapie vor und gebe nach und nach weitere Informationen, die vielleicht später zu einer bewussteren Entscheidung führen.
Manche wollen sehr viele Details wissen, andere fühlen sich insbesondere zu Beginn schnell überfordert. Als Arzt muss man ein Gespür dafür haben, wo die Patientin gerade steht und wie stark sie einbezogen werden möchte.
Ich lebe mit meiner Krankheit, doch sie bestimmt meinen Alltag nicht.
Hätten Sie damals – im anfänglichen Schock – überhaupt eine Entscheidung treffen können, Esther?
Esther: Bei meiner ersten Ärztin wurde mir einfach mitgeteilt, welches Medikament verabreicht wird; Alternativen wurden nicht besprochen. Ich hätte damals auch gar nicht mitentscheiden können, ich hatte ja keinerlei Kenntnisse. Erst mit der Zeit wird man zur Expertin der eigenen Krankheit und kann aktiv mitreden. Zu Beginn der Diagnose ist es vor allem wichtig, dass man Antworten auf seine Fragen bekommt und dass sich der Arzt dafür Zeit nimmt.
Was raten Sie Betroffenen im Umgang mit den Belastungen?
Lehmann: Ich vergleiche Myelofibrose gerne mit einem Rucksack, den man nicht ablegen kann. Es gibt Phasen, in denen er kaum spürbar ist, und andere, in denen er richtig schwer wiegt. Wichtig ist, die guten Zeiten bewusst zu geniessen. Aktiv zu bleiben, Bewegung und Sport, all das kann helfen. Und Schritt für Schritt den Raum zurückzuerobern, den die Krankheit einschränkt.
Esther: Genau, ich versuche auch, mich auf die schönen Dinge zu konzentrieren und mich aufzurappeln, auch wenn ich eigentlich lieber auf dem Sofa liegen würde. Bewegung hilft, der Austausch mit anderen Betroffenen, das Zusammensein mit Freunden und sich Hilfe zu holen.
Datum: 09.10.2025
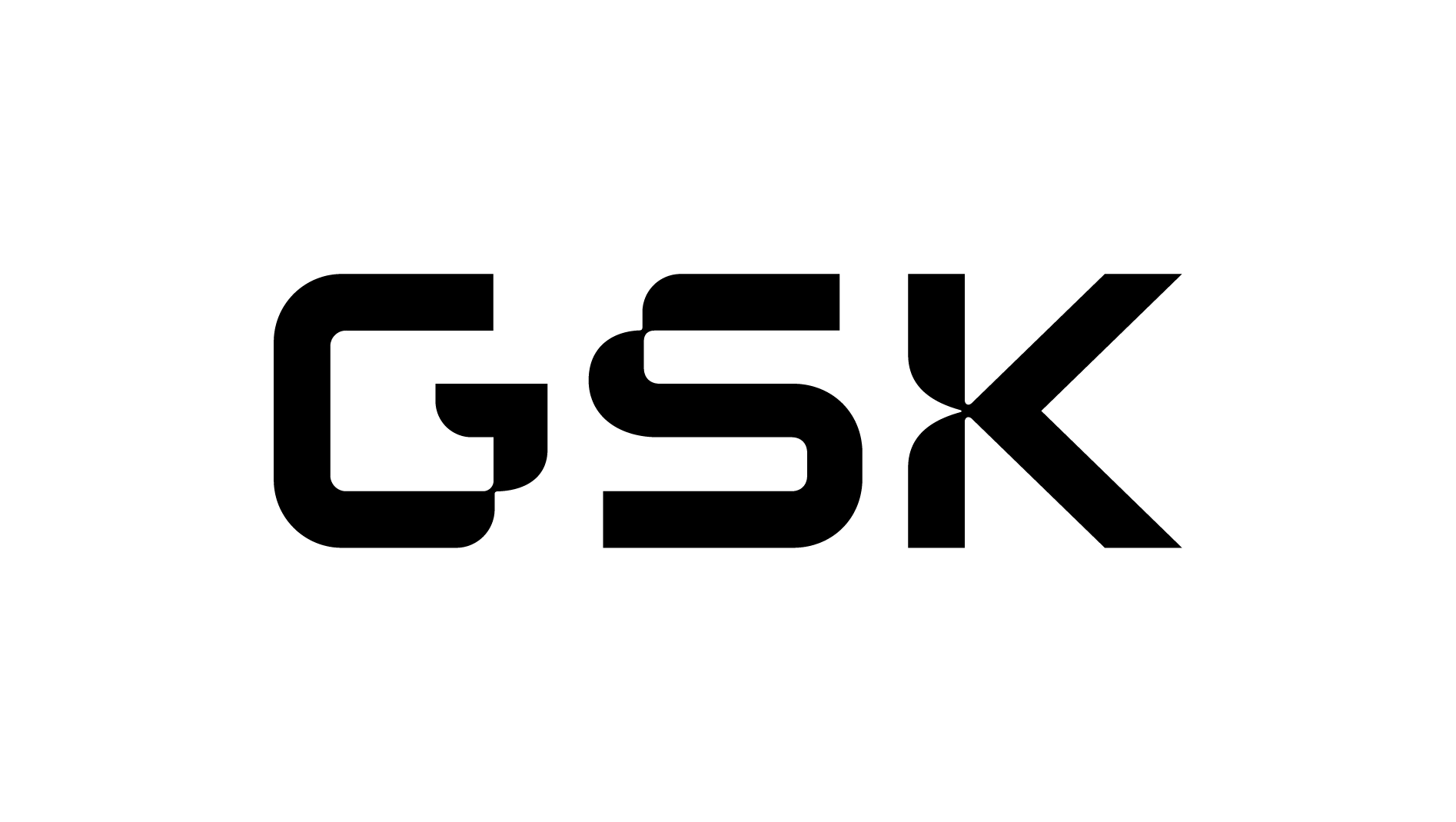
GSK ist ein weltweit forschendes Gesundheitsunternehmen mit dem Anspruch, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Unsere Arbeit in der Onkologie konzentriert sich darauf, die Überlebenschancen von Patient*innen durch innovative Medikamente zu erhöhen. Wir setzen uns für Menschen mit Krebs ein.